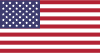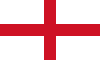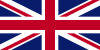Top 26 Zitate und Sprüche von Alex Tizon
Entdecken Sie beliebte Zitate und Sprüche des philippinischen Autors Alex Tizon.
Zuletzt aktualisiert am 6. November 2024.
Die Vorstellung, dass die Menschheit in diese getrennten, unterschiedlichen und unterschiedlichen Gruppen mit klaren Grenzen unterteilt ist, wurde von der Wissenschaft vor langer Zeit, vor Jahrzehnten, widerlegt. Die Menschheit ist eigentlich eher ein Kontinuum, und die Menschen gehören zum selben Kontinuum und es gibt keine klaren Brüche zwischen diesen sogenannten Rassen.
Bei der Darstellung asiatischer Menschen in Filmen, Büchern und im Fernsehen oder als historische Figuren ist es wichtiger, sie zu humanisieren und ihnen alle Dimensionen der Menschlichkeit zu vermitteln, und dazu gehört auch die Sexualität. Schreiben Sie dem Menschen die gesamte Bandbreite menschlicher Qualitäten zu.
Man könnte wohl sagen, dass ich als Journalist viel über eine Sache geschrieben habe. Aber ich habe es kaum jemals als ausschließlich eine Frage der Rasse betrachtet. Meiner Meinung nach ging es eher darum, Geschichten von Menschen zu erzählen, die außerhalb des Sichtfelds des Mainstreams existierten. Unsichtbare Menschen.
Ich besuchte die Philippinen zum ersten Mal mit 29 Jahren. Ich dachte, ich würde mich dort zu Hause fühlen, aber ich fühlte mich fehl am Platz als in den USA. Ich stellte fest, dass ich eher Amerikaner als Filipino war. Es war erschütternd, weil ich mich in den USA auch nie ganz zu Hause gefühlt habe.
Ich glaube, im Westen herrschte schon lange die Vorstellung, Asien sei ein Kontinent mit Menschen, die wirklich eroberbar seien. Dass die Menschen aus Asien schwach waren, sie waren in jeder Hinsicht klein – auch körperlich klein, geopolitisch klein, wirtschaftlich klein – und all das verändert sich natürlich.
Ich habe mich nicht für den Journalismus entschieden, weil ich dachte, das würde meine Identität festigen. Ich habe es getan, weil ich meinen Lebensunterhalt verdienen musste, und ich konnte gut schreiben. Aber als ich Journalist wurde, lernte ich andere Menschen kennen, die das Gefühl hatten, am Rande des amerikanischen Mainstream-Lebens zu stehen.
Fernsehen und Kino waren unsere größten Lehrmeister. Als wir in die Vereinigten Staaten kamen, war der Vietnamkrieg gerade in vollem Gange. Und so waren die asiatischen Gesichter, die ich in den Nachrichten sah, das Gesicht des Feindes. Vor allem asiatische Männer waren entweder klein, wirkungslos oder böse. Und diese Botschaften waren viele Jahre lang tief in mir verankert.
Die Wahrheit zuzugeben hätte bedeutet, uns alle bloßzustellen. Wir verbrachten unser erstes Jahrzehnt auf dem Land, lernten die Gepflogenheiten des neuen Landes kennen und versuchten, uns anzupassen. Einen Sklaven zu haben passte nicht. Die Tatsache, dass ich einen Sklaven hatte, ließ mich ernsthaft daran zweifeln, was für Menschen wir waren und woher wir kamen.
In dem Amerika, in dem ich aufgewachsen bin, standen Männer aus Asien in der Hierarchie der Männlichkeit an letzter Stelle. Sie waren in den Testosteron-Arenen der Politik, der Großwirtschaft und des Sports unsichtbar. Im Fernsehen und im Kino waren sie mehr als unsichtbar. Sie waren peinlich. Wir waren peinlich.